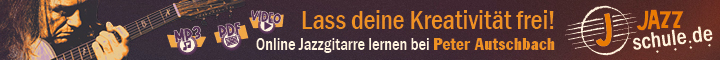Balance Baritone
![]()
Tiefergelegt
Balance/Kirkland Baritone Gitarren
Von Andreas Schulz
Interessante Instrumente für Individualisten: Balance/Kirkland Baritone Gitarren
Der Test dieser beiden Balance Bariton-Modelle ist aus mehreren Gründen hochinteressant. Schließlich sind Bariton-Gitarren nicht  gerade an der Tagesordnung, zudem sind die vorliegenden elektro-akustischen Kreationen technisch wie optisch bemerkenswert, und schlussendlich können wir das handgefertigte Original direkt mit dem weniger als halb so teuren Fernost-Modell vergleichen.
gerade an der Tagesordnung, zudem sind die vorliegenden elektro-akustischen Kreationen technisch wie optisch bemerkenswert, und schlussendlich können wir das handgefertigte Original direkt mit dem weniger als halb so teuren Fernost-Modell vergleichen.
Johannes Vogel (geb. 1959), Erfinder und Erschaffer der Balance-Gitarren, lernte als Kind Klavier und Cello, entdeckte später die E-Gitarre und gründete 1989 mit einem Partner die Firma „Custom Made Guitars“. Schwerpunkt sind anspruchsvolle Sonderanfertigungen, Umbauten und Restaurierungen. Aus den gewonnen Erfahrungen entstanden die Balance-Instrumente, gedacht als kreative Lösungen für individuelle Spieler. Zum Test erhielten wir eine Balance Bariton-Guitar sowie das entsprechende, in Lizenz in China gebaute Fernost-Pendant.
Konzept
Der Einfachheit halber beschreiben wir zunächst das von Johannes Vogel gebaute Instrument und vermerken die Unterschiede der „Kirkland-Version“. Basis ist ein leicht abgewandeltes Design im Stratocaster-Stil. Die Korpus-Hörner sind verlängert, das weiche Shaping der Kanten wird man bei der Balance vergeblich suchen. Der Korpus besteht aus zwei massiven Mahagoni-Stücken und ist im Innern in drei Klangkammern unterteilt. Die Gitarre ist zum größten Teil hohl und hat entsprechend ein angenehm geringes Gewicht. Das Holz besitzt eine attraktive Maserung und hat durch die perfekte Hochglanzlackierung eine fast dreidimensionale Wirkung. Die Decke besteht aus zwei Fichtenflügeln und einem erhöhten Mittelstreifen aus Mahagoni. Auch hier gilt: die Hölzer sind von guter Qualität, ebenso Verarbeitung und Lackierung. Vier kleine Schalllöcher wurden in einem Halbkreis in die Decke gefräst. Umrahmt ist der Korpus von einem elfenbeinfarbenen Plastik-Binding und einer mehrstreifigen Perlmutt-Einlage. Die optische Wirkung ist trotz des ungewöhnlichen Designs gediegen und dürfte auch konservative Naturen nicht vor den Kopf stoßen.
Der dreiteilige Ahornhals ist eingeleimt und ebenfalls von einem Binding umrahmt. Die Kopfplatte ist recht deutlich nach hinten abgewinkelt, hat eine elegant geschwungene Form und trägt die Mechaniken in unsymmetrischer 3/3-Anordnung. Der Übergang zwischen Hals und Kopfplatte ist auffallend kräftig ausgefallen, der Headstock selbst ist mit Mahagoni furniert, in das die kleinflügeligen Mechaniken leicht versenkt eingebaut wurden. Das feinporige Palisander-Griffbrett trägt 24 Medium-Jumbo-Bünde, die perfekt eingelassen und abgerichtet sind. Einzige Verzierung ist ein Mother-Of-Pearl-‚Balance‘-Inlay am 12. Bund. Das Griffbrett ist etwas breiter als bei einer Standard-Gitarre, die Maße sind am Sattel ca. 4,6 cm, am 12. Bund ca. 5,5 cm. Auch die Mensur ist naturgemäß verlängert: wir messen 68,5 cm bei der hohen und 69 cm bei der tiefen E-Saite. Das rückseitige Hals-Shaping entspricht einem stark abgeflachten ‚D‘. Trotz der vergrößerten Maße lässt sich der Hals leicht und angenehm spielen. Man bekommt spontan eine gute Verbindung zur Balance-Bariton und kann praktisch wie auf jeder anderen Gitarre spielen. Auch Spieler mit tendenziell kleinen Händen dürften kaum Probleme haben. Dank der weit in den Korpus gezogenen Cutaways ist der oberste Halsbereich gut zugänglich (Hals-Korpus-Übergang am 17. bzw. 21. Bund). Brücke und Saitenhalter bestehen aus Palisander und sind passend zum individuellen Gesamt-Design geformt. Die Brücke ist nicht fest verleimt und lässt sich zur etwaigen Korrektur der Intonation verschieben. Die Saiten werden mit Pins verankert und laufen über sechs dreieckig geformte Stegreiter, unter denen der Piezo-Pickup sitzt. Als zweiter Tonabnehmer wurde in Hals-Position in einem Holzrahmen ein Shadow-Humbucker höhenverstellbar eingebaut. Sollte die Halskrümmung einer Veränderung bedürfen, muss man den Pickup entfernen und erhält dann Zugang zum Halsstab.
Die „Balance by Kirkland“ zeigt einige Unterschiede. So ist die Mensur ca. einen Zentimeter länger, der Hals entspricht mit 4,3 bzw. 5 cm (Sattel/12. Bund) dem normalen Maß. Für den Korpus wurde hier bei ansonsten identischer Auswahl massive Erle verwendet. Die Korpusdimensionen weichen leicht ab, das gilt auch für die Bundierung mit schmalen und flachen Stäbchen. Logischerweise wurde bei der Materialauswahl gespart, allerdings auf qualitätserhaltende Weise. Verarbeitung und Lackierung sind auf einem dem Preis gemäßen Niveau, kleinere Unsauberkeiten wird man gern verzeihen. Kritisch zu werten ist allerdings die Tatsache, dass sich die Saitenaufhängung leicht von der Decke gelöst hat; auf der Rückseite ist ein Spalt sichtbar. Könnte sein, dass sich das Palisanderteil demnächst komplett löst – hier sollte der Hersteller unbedingt die Qualitätskontrolle optimieren. Unterm Strich ist auch die „China-Balance“ ein angenehmes und ausgereiftes Instrument, das sich komfortabel handhaben lässt. Es wurde an den richtigen Stellen modifiziert und gespart. Auffallend ist das spürbar geringere Gewicht des Fernost-Modells.
Elektronik
Die „Balance“-Bariton ist mit einem Piezo im Steg und einem magnetischen Humbucker in Halsposition ausgestattet. Beide Aggregate stammen vom deutschen Hersteller Shadow. Auf der Rückseite befindet sich ein einfach zu öffnendes Batteriefach und ein 3-Band-EQ für den Piezo in Form von drei versenkten Mini-Potis. Drei weitere Drehregler sitzen auf der Decke: ein Master-Volume, ein Piezo/Humbucker-Mix-Regler mit Mittenrasterung und ein passiver Tonregler für den Magnet-Pickup. Letzterer ist ein Push/Pull-Poti und schaltet den Mono bzw- Stereo-Betrieb. Das so geformte Signal der Balance-Baritone wird über eine Stereo-Klinkenbuchse in der unteren Zarge ausgegeben. In Sachen Elektronik unterscheidet sich die Kirkland deutlich. Der magnetische Tonabnehmer ist ein Humbucker im Single-Coil-Format (also deutlich schmäler), außerdem wurde auf den EQ für den Piezo komplett verzichtet. Die Batterie ist etwas fummelig hinter einer abschraubbaren Blende verborgen, in dem darunter liegenden Fach liegt die Platine der elektrischen Schaltung lose herum (eine Art aufklebbarer Klett-Verschluss hatte sich gelöst). Hier ist dringend eine Verbesserung gefordert, außerdem ist der Austausch der Batterie unnötig schwierig. Die Regelung der Kirkland erfolgt über zwei Potis für die Lautstärken der beiden Tonabnahme-Systeme. Eine Klangregelung entfällt gänzlich, außerdem ist das System mono ausgelegt. Nun gut, über den Piezo-EQ kann man reden, aber dass es gar keinen Klangregler gibt, außerdem keinen praxisgerechten Mischungsregler und keine Stereo-Option, ist bedauerlich. Hier wurde Einiges von dem ansonsten guten Potential des Fernost-Instrumentes verschenkt.
Den vollständigen Artikel finden Sie in AKUSTIK GITARRE 01/03